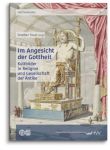(herausgegeben von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesmuseum Mainz, bearbeitet von Ellen Riemer)
Als 2014 die Steinhalle des Landesmuseums Mainz vorübergehend zum Plenarsaal des rheinland-pfälzischen Landtags umgebaut werden sollte, musste auch die Große Mainzer Jupitersäule, eines der bedeutendsten römischen Denkmäler der Stadt Mainz, nach 50 Jahren umziehen. Die vor dem Umzug durchgeführten Untersuchungen brachten zahlreiche Schäden ans Licht, die eine umfangreiche Restaurierung der Säule notwendig machten.
Der vorliegende Band stellt zum einen die zwischen 2015 und 2021 durchgeführten Maßnahmen ausführlich vor, die unter anderem mit Stiftungsgeldern und privaten Spenden finanziert wurden. Daher ist das Buch durchaus auch als Rechenschaftsbericht zu verstehen. Zum anderen informiert das Werk über die Geschichte der Säule seit ihrer Entdeckung sowie über ihr Bildprogramm und ihre Bedeutung für das römische Mainz.
Nach einer kurzen Einführung in das Restaurierungsprojekt und einer Vorstellung des beteiligten Teams durch Ellen Riemer, der Kuratorin für Archäologie im Landesmuseum Mainz, stellt sie uns „Geschichte, Bedeutung und Rezeption“ der Jupitersäule vor. Unsere Zeitreise führt uns zunächst zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als man 1904 bei Bauarbeiten in der Sömmerringstraße 6 in der Mainzer Neustadt auf Reste eines römischen Denkmals stieß. Insgesamt barg man rund 2000 Einzelteile, die in mühsamer Kleinarbeit zusammengesetzt wurden. Das Ergebnis: die Große Mainzer Jupitersäule.
Unsere Reise durch die Geschichte der Jupitersäule führt uns dann zu ihren verschiedenen Aufstellungsorten und stellt auch einige Kopien vor, die schon früh angefertigt wurden. Eine der bekanntesten befindet sich heute im Freilichtmuseum Saalburg.
Jens Dolata von der Außenstelle Mainz der Direktion Landesarchäologie ordnet anschließend die Jupitersäule in den topographischen Kontext des römischen Mogantiacum ein und stellt den Siedlungsplatz Dimesser Ort vor, wo die Reste der Jupitersäule gefunden wurden. Hier wurden gerade in jüngster Zeit interessante Funde gemacht, die es zusammen mit den Inschriften der Säule und des dazugehörigen Altars erlauben, Aussagen über die Bewohner dieses Siedlungsbereichs zu machen.
Im folgenden Kapitel stellt Patrick Schollmeyer vom Institut für Altertumswissenschaften der Universität Mainz das Bildprogramm der Großen Jupitersäule vor. Auch er analysiert noch einmal die Inschrift und vergleicht die Form der Mainzer Säule mit anderen antiken Säulenmonumenten. Anschließend geht er zunächst auf die bisherigen Benennungen der dargestellten Götter und Personifikationen ein. Während viele der Figuren durch Attribute eindeutig bestimmbar sind, gibt es doch einige, deren Identifizierung umstritten sind. Bei diesen Figuren schlägt Schollmeyer lokale Bezüge vor, mit denen sich der antike Betrachter des Bildprogramms im römischen Mainz identifizieren konnte.
Die nächsten Kapitel widmen sich den einzelnen Schritten der Restaurierungsmaßnahmen. Michael Auras vom Institut für Steinkonservierung führte erste Untersuchungen des Materials der Säule durch, bevor für tiefergehende Untersuchungen die Computertomographie zum Einsatz kam. Anna Steyer von der Firma Steyer Restaurierung gibt zunächst einen Überblick über die Grundlagen der industriellen Computertomographie und ihre Anwendungsbereiche. Sie zeigt in ihrem Beitrag mit welchen Methoden man bei der Mainzer Säule vorging und zu welchen Ergebnisse man gelangte. Zwar zeigten sich im Fall der Säule auch die Grenzen der industriellen Computertomographie für die Archäologie, aber die Ergebnisse lieferten trotzdem wichtige Informationen für die Planung der folgenden Restaurierungsmaßnahmen.
Die umfangreichen Voruntersuchungen erlaubten nicht nur eine Musterrestaurierung am Inschriftensockel, sondern auch genaue Vorgaben für die Restaurierung der übrigen Säulenteile, die dann in Form einer Bewertungsmatrix in die Ausschreibung Eingang fanden. Karin Schinken vom Landesamt für Denkmalpflege zeigt uns in ihrem Beitragt, wie diese Matrix erstellt wurde. Auf die Geschichte der verschiedenen Restaurierungskonzepte von der Auffindung der Säule bis heute geht das Autorenteam dann in einem gemeinsamen Beitrag ausführlich ein.
Im letzten Beitrag beschreiben Matthias Steyer und Katrin Elsner von der Firma Steyer Restaurierung die einzelnen Schritte des Restaurierungsprojektes. Dabei gehen sie auch auf einige Aspekte der vorangegangenen Beiträge nochmals ein. So z. B. auf die optische Voruntersuchung. Ausführlich werden die Maßnahmen beschrieben, die notwendig waren, um die Säule abzubauen. Nach der Entwicklung des endgültigen Konservierungskonzeptes anhand der Sicherung und Stabilisierung des Inschriftensockels sowie der Bearbeitung seiner Oberflächen erfolgte die Ausschreibung der Restaurierung der übrigen Säulenteile, bei der sich die Firma Steyer Restaurierung gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. Ihr detaillierter Bericht über ihre Arbeit wird im anschließenden Tafelteil zudem gut illustriert. Jeweils vier Fotos zeigen den Zustand der einzelnen Teile 1906 sowie vor, während und nach der Restaurierung.
Insgesamt legt das Autorenteam anhand der Großen Mainzer Jupitersäule eine gelungene und sehr detaillierte Einführung in die Geschichte der Restaurierungsmöglichkeiten und -konzepte für Steindenkmäler seit ihrer Auffindung vor. Das Buch zeigt dabei anschaulich, wie viele Einzelmaßnahmen und Überlegungen im Rahmen einer Restaurierung notwendig sind, um ein solches Objekt für das Publikum aufzubereiten.
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland- Pfalz,
Landesmuseum Mainz (Hrsg.), bearbeitet von Ellen Riemer
Die Große Mainzer Jupitersäule – Archäologie, Geschichte und Restaurierung
Nünnerich-Asmus Verlag
176 Seiten, 85 Abbildungen, geb.
€ 25,00 (D) / € 25,70 (A)
ISBN: 978-3-96176-189-0
Das Buch ist unter anderem bei Amazon erhältlich. Ein Klick auf das Bild führt direkt dorthin.