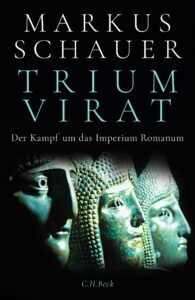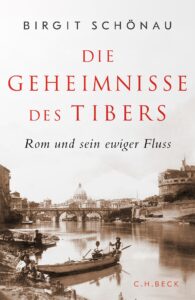Das erste Triumvirat, der Dreierbund von Pompeius, Crassus und Caesar markierte den Höhepunkt politischer Umwälzungen, die die römische Republik aus den Angeln werfen und den Weg für die Kaiserzeit bereiten sollten. Aber wie konnte es dazu kommen? Welche Voraussetzungen ebneten ihnen den Weg zu beispiellosen Karrieren? Was trieb sie an? Und wie schafften sie es, den römischen Staat in ihre Hände zu bekommen? Diesen Fragen widmet sich Markus Schauer in seinem Buch, in dem er virtuos die Biografien der drei Protagonisten mit den historischen Rahmenbedingungen verbindet.
Zu Beginn nimmt Schauer uns mit in die Gedanken und Gefühle, die jeden der drei späteren Triumvirn am Vorabend umgetrieben haben könnten. Rivalität untereinander, aber auch verletzter Stolz, Eitelkeit und maßloser Ehrgeiz, die letztendlich dazu führten, dass sie sich gegen den gemeinsamen Feind, den Senat, zusammenschlossen.
Doch, während die antiken Geschichtsschreiber die Bürgerkriege und den Untergang der römischen Republik im 1. Jahrhunderts v. Chr. diesen drei mächtigen Männern zuschrieben, zeigt Schauer, dass erst die schon Jahrzehnte zuvor begonnenen gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen es ihnen ermöglichten, so viel Macht auf sich zu vereinen.
Nach einem theoretischen Teil zu antiker und moderner Geschichtsforschung schildert er ausführlich die Kämpfe zwischen Optimaten und Popularen, also zwischen Senat und Volksversammlung. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzungen standen so bekannte Namen wie Tiberius und Gaius Gracchus oder Marius und Sulla. Aber auch sie agierten nicht im Vakuum. Viele innere und äußere Faktoren machten diese Umwälzungen möglich und notwendig – Umwälzungen, die in blutigen Bürgerkriegen und unter Sulla mit einem unvorstellbaren Blutbad unter den Popularen führte.
Dies war die Zeit, in der Crassus, Pompeius und Caesar ihre Jugend erlebten und sich die ersten Sporen als Feldherrn verdienten. Aber bis 60 v. Chr. waren sie für die Optimaten im Senat zu mächtig geworden. Immer wieder legte man ihnen Steine in den Weg. Demütigungen und Rückschläge für ihre Ambitionen waren die Folge. Caesar gelang es, die Rivalen Crassus und Pompeius zu überzeugen, über ihren Schatten zu springen und sich ihm in einem geheimen und zunächst privaten Dreibündnis anzuschließen, um die ihnen
Das „dreiköpfige Ungeheuer“, wie dieses erste Triumvirat schon in der Antike genannt wurde, dominierte bald den Senat und setzte seine Wünsche oft gegen geltendes Recht und teilweise unter Anwendung von Gewalt durch. Das Ergebnis war eine ungeheure Machtfülle für die drei. Tatsächlich hatten die Triumvirn mehr oder weniger das ganze Imperium Romanum unter sich aufgeteilt.
Detailliert schildert Schauer die Aktivitäten der drei Männer aus verschiedenen Blickwinkeln. Manchmal ergeben sich daraus Wiederholungen, die es jedoch auch einfacher machen, den komplizierten Vorgängen zu folgen. Denn es ist ein ständiges Mit- und Gegeneinander, das diesen Dreibund prägt. Wie Schauer zeigt, ist es vor allem Caesar zu verdanken, dass das Triumvirat so lange Bestand hatte und Differenzen mit Blick auf das gemeinsame Ziel in den Hintergrund traten.
Auch die Hintergründe des Gallischen Kriegs Caesars werden beleuchtet. Geschickt sorgte er dafür, dem Senat einen Grund für diesen Krieg verkaufen zu können. Denn Ruhm brachte nur ein „gerechter Krieg“, also ein Krieg, um das römische Reich selbst oder Bündnispartner zu verteidigen. Und solche Kriege zu inszenieren, darin war Caesar ein Meister. Immer wieder zog er den Krieg in Gallien in die Länge, hob immer wieder neue Legionen aus und war schließlich Herr über 13 Legionen.
Der Tod Iulias, der Tochter Caesars, die mit Pompeius verheiratet war, markiert den Anfang vom Ende des Triumvirats. Als wenig später auch Crassus im Kampf starb, zeichnete sich ab, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis die Rivalität zwischen Caesar und Pompeius nun offen zutage treten würde.
Und so standen sich die beiden schließlich in einem blutigen Bürgerkrieg gegenüber, aus dem Caesar 45 v. Chr. als Sieger hervorging. Allerdings konnte er seine Alleinherrschaft über das Imperium Romanum bekanntermaßen nicht lange genießen, da nur ein Jahr später einer Verschwörung zum Opfer fiel.
Schauer lässt die damaligen Geschehnisse anhand antiker Quellen lebendig werden. Vor allem die Briefe Ciceros an seinen Freund Atticus geben einen tieferen Einblick hinter die Kulissen der Machtkämpfe zwischen den Triumvirn, aber auch zwischen Popularen und Optimaten. Immer wieder versuchte Cicero zwischen den beiden Kontrahenten zu vermitteln.
Das abschließende Resümee geht schließlich auch darauf, welche Fehler jedes einzelnen der Triumvirn dazu führten, dass keiner der drei sich auf Dauer durchsetzen konnte. Auch macht Schauer die Unterschiede zwischen Caesars Politik und jener des Augustus deutlich, dem letztendlich das gelang, was Caesar verwehrt blieb: die Schaffung einer neuen Staatsform unter einem Alleinherrscher.
Schauers Buch über das Triumvirat von Caesar, Pompeius und Crassus bietet neben der dreifachen Biografie der drei Protagonisten auch einen gelungenen Einblick in die römische Gesellschaft am Ende der Republik. Er zeigt, wie die Aristokratie dachte, welche Werte sie vertrat und wie gerade das Beharren auf diesen Werten und ihren Privilegien in der Auseinandersetzung mit popularen Strömungen den Machtzuwachs einzelner erst möglich machte.
Markus Schauer, Triumvirat. Der Kampf um das Imperium Romanum. Caesar, Crassus, Pompeius (2023)
978-3-406-80645-2
Erschienen am 21. September 2023
429 S., mit 7 Abbildungen und 2 Karten