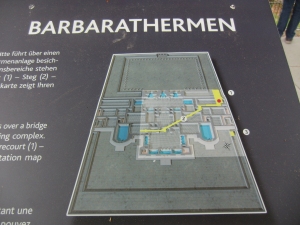In der klassischen Zeit (ca. 480 – 323 v. Chr.) werden die Grabstelen breiter. Die alten Themen wie Athletik, Jagd und Krieg werden jetzt seltener dargestellt und ganz selten sind Darstellungen einer bestimmten Aussage über den Toten. Stattdessen finden wir jetzt vor allem mehrfigurige Darstellungen mit einfachen „Lebensbildern“. Dabei sind meist polare Paare wie Mann und Frau, Mutter und Kind, Herrin und Dienerin usw. dargestellt, wobei die Szenen oft eine Atmosphäre der Trauer vermitteln. Die Deutung der Darstellungen ist allerdings umstritten. Bekannte Beispiele sind das Hegeso-Relief, die Theano-Stele und die Alxenor-Stele.
Im Hellenismus setzen in Athen, das in bisher in der Grabkunst führend war, wegen des Anti-Luxus-Gesetzes des Demetrios von Phaleron die Grabdenkmäler aus. Insgesamt kann man sagen, dass die Grabdenkmäler der hellenistischen Welt relativ einheitlich waren. Es werden allgemeine Szenen dargestellt. Beliebt werden beispielsweise Szenen, in denen die Familie tafelt (kein Totenmahl!). außerdem werden Standesabzeichen beigefügt. Individuelle Szenen sind dagegen selten.
Einige Fürsten und andere Personen der führenden Schichten ließen aber in dieser Zeit auch Grabdenkmäler errichten, die über das Übliche hinausgehen. Bekanntestes Beispiel ist sicher das Maussoleum von Halikarnassos in der heutigen Türkei (360-330 v. Chr.). Das iGrabmal bestand aus einem hohen Sockel, über dem sich ein tempelartiger Aufbau erhob. Man fand 2 Statuen, die vermutlich Maussolos und seine Frau Artemisia darstellen.
Ein ähnliches Grabmal ist das Nereidenmomunent (London, British Museum). Auch hier erhebt sich ein tempelartiger Aufbau, der die Grabkammer enthält, auf einem Sockel. Andere monumentale Grabformen können Felsgräber (z. B. in Kaunos) oder Hügelgräber (z. B. Grab Phillips II. in Vergina) sein. Insgesamt gibt es nur wenige monumentale Gräber. Ihr Bildschmuck stellt keine Leistungen des Verstorbenen mehr dar. Stattdessen wirken die Bauten für sich.