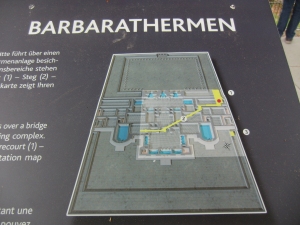Unter Kaiser Konstantin wurden in Rom verschiedene Kirchen gebaut. Darunter die Lateransbasilika als erste Gemeindekirche. San Giovanni in Laterano war auch die erste Bischofskirche und ist die einzige römische Basilika konstantinischer Zeit, die innerhalb der Stadtmauern lag. Alle anderen großen Basiliken entstanden außerhalb der Stadtmauern, da sie im Zusammenhang mit Gräbern entstanden.
Christliche Basiliken verwendeten Elemente römischer Profanbauten, sodass zum Teil nur die Inneneinrichtung zeigt, ob es sich um einen christlichen Bau handelt. Kennzeichen christlicher Basiliken sind unter anderem Obergaden mit Fenstern, die über die Seitenschiffe herausragen, und damit verbunden die Hierarchie der Innenausstattung durch die Ausrichtung auf das Mittelschiff mit der Apsis.
Die konstantinische Lateransbasilika war fünfschiffig und besaß einen hohen Obergaden, der auf Säulenkolonnaden ruht, und ein mit Holz gedecktes Dach. Alles ist nach innen orientiert und die Innenausstattung unterstützt die Hierarchie des Innenraums. Architektur und Ausstattung ergänzen einander.
Über dem Altar erhob sich wohl ein von Konstantin gestifteter und auf Säulen ruhender silberner Aufsatz, ein Ziborium. Eine solche Anlage betonte und erhöhte einen bestimmten Platz, z. B. ein Märtyrergrab. Die Skulpturen an den Giebeln waren der Überlieferung nach aus reinem Silber. Zur Gemeinde hin thronte Christus inmitten der Apostel, zur Apsis hin zwischen vier Engeln.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Basilika immer wieder umgebaut, aber ihre Bedeutung blieb: noch heute ist San Giovanni in Laterano die Kirche des Papstes als Bischof von Rom und die ranghöchste der Papstbasiliken.