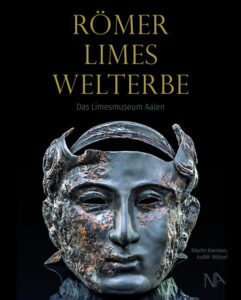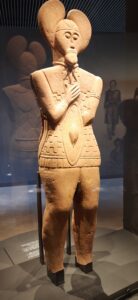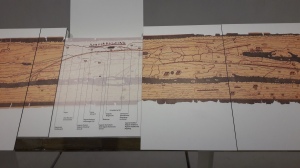Trier ist bekannt für seine eindrucksvollen Landesausstellungen, die sich über mehrere Museen erstrecken. Nach den römischen Kaisern Konstantin und Nero stellt das Landesmuseum Trier dieses Jahr Marc Aurel vor, der den meisten Menschen heute als Philosophenkaiser ein Begriff ist. Seine „Selbstbetrachtungen“ dienten schon vielen Prominenten als Anleitung für ihr Leben, darunter Helmut Schmidt oder Bill Clinton.
Trotz der Bekanntheit Marc Aurels ist die Ausstellung in Trier die erste große Schau, die sich ganz seinem Leben widmet. Die Begleitbände sind, wie bei solchen Projekten üblich, keine reinen Kataloge der ausgestellten Fundstücke. Die reich bebilderten Bücher vertiefen die Informationen der Ausstellungen.
Der Begleitband zum Ausstellungsteil “ Marc Aurel. Kaiser, Feldherr, Philosoph“ im Landesmuseum bietet zunächst eine knappe Zusammenfassung von Marc Aurels Leben – beginnend mit seiner Adoption durch Antoninus Pius wird seine Biografie in den historischen Kontext eingebettet: Hadrian, Antoninus Pius, Marc Aurel, Lucius Verus und schließlich der Übergang zu Commodus.
In den nachfolgenden Kapiteln gehen die Autoren ins Detail. Herkunft, Adoption und Herrschaft von Markus Annius Catilius Severus, wie er ursprünglich hieß, werden ausführlich beleuchtet. Einen genauen Überblick über die verwandtschaftlichen Verhältnisse geben zwei Stammbäume: einer von Marc Aurels Familie, der andere den der Adoptivkaiser.
Da sein Vorgänger Antoninus Pius unerwartet lange lebte, blieb Marc Aurel ganze 23 Jahre lang „Kronprinz“ – eine einmalige Konstellation, durch die er als einer der bestvorbereiteten Kaiser Roms in die Geschichte einging. Als Marc Aurel 161 n. Chr. endlich seine Herrschaft antreten konnte, machte er seinen Adoptivbruder Lucius Verus zum Mitkaiser – ein Novum in der Geschichte der römischen Kaiser. Dieses Modell sollte Schule machen und sich als zukunftsweisend erweisen.
Bereits in der Antike galt Marc Aurel als guter Herrscher – wenn auch aus anderer Perspektive gesehen. Der römische Historiker Cassius Dio bezeichnete ihn sogar als Idealkaiser. Dennoch war seine Regierungszeit geprägt von zahlreichen Kriegen und Krisen wie der Antoninischen Pest oder den Kriegen gegen die Parther und die Markomannen. Diese unsicheren Zeiten führten zu einem verstärkten Sicherheitsbedürfnis im Reich: Die Armee wurde aufgerüstet und überall entstanden Stadtmauern.
Die Ausstellung und der Begleitband gehen auch auf die Personalpolitik Marc Aurels ein, auf Wirtschaft und Handel während seiner Regierung sowie auf Carnuntum, in der Nähe von Wien gelegen, wo er zusammen mit seiner Familie und seinem Gefolge während des Markomannenkriegs sein Hauptquartier aufschlug.
Ein eigener Abschnitt ist natürlich Marc Aurels „Selbstbetrachtungen“ und dem Stoizismus gewidmet. Nach einem allgemeinen Überblick über die historische Entwicklung der philosophischen Kultur im Römischen Reich und speziell des Stoizismus, geht das Buch auf das Verhältnis Marc Aurels zur Philosophie und auf seine „Selbstbetrachtungen“ ein. Die Einteilung in zwölf Bücher mit insgesamt 490 Kapiteln ist wohl eine spätere Zusammenstellung. Im ersten Buch dankt Marc Aurel den Göttern und all jenen Personen, die ihn in seinem Leben gefördert haben. Dabei verbindet er jede dieser Person mit bestimmten Tugenden, die ihn geprägt haben. Die übrigen Bücher enthalten Marc Aurels philosophische Überlegungen zu diesen Tugenden und Hinweise zu guter Lebensweise.
Diese „Selbstbetrachtungen“, die wohl nie zur Veröffentlichung gedacht waren, zeigen seine persönliche Lebenseinstellung und sind rein privat. Gleichzeitig war er sehr pflichtbewusst, was seine kaiserlichen Pflichten angeht: Schutz und Verteidigung des Reiches und der Bürger. Und das machte ihn für seine Zeitgenossen und folgende Generationen von Römern zu einem guten Herrscher. Für heutige Bewunderer seiner philosophischen Gedanken ist es dagegen verstörend, wenn sie auf der Marcus-Säule in Rom zahlreiche Szenen sehen, die wir heute Kriegsverbrechen als ansehen.
Ein weiterer Abschnitt des Begleitbands stellt wichtige Denkmäler vor, die mit Marc Aurel verbunden sind: Natürlich die Marcus-Säule und das Reiterstandbild in Rom, aber auch das Parthermonument in Ephesos, zahlreiche Portrait-Büsten, Münzen und Medaillons sowie die Bautätigkeit Marc Aurels in Rom und den Provinzen.
Die nördlichen Provinzen Gallia Belgica, Germania Superior und Germania Inferior repräsentieren bespielhaft die zunehmend unruhigen Zeiten unter Antoninus Pius und Marc Aurel. Zahlreiche Konflikte mit einfallenden germanischen Gruppen wie den Chatten zeigen sich in archäologischen Spuren von Zerstörungen ebenso wie dem Bau von Stadtbefestigungen, wie im Falle von Trier.
Nicht fehlen darf in diesem Begleitband zur Landesausstellung selbstverständlich eine Auseinandersetzung mit der Wiederentdeckung und Rezeption der „Selbstbetrachtungen“ bis heute. Auch wenn sich der Rezeption dieses Bestsellers und der Frage nach dem, was gute Herrschaft ausmacht, vor allem die Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift widmet.
Im Epilog wird noch einmal ein Fazit unserer Kenntnisse über Marc Aurel gezogen, bevor die Ausstellungsstücke in einem Katalog vorgestellt werden und das Buch mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis abschließt.
Und mein Fazit? Ausstellung und Begleitband unterstreichen einmal mehr, dass es sich lohnt, einen Blick hinter die Kulissen der römischen Antike zu werfen oder sich ihr mit neuen Fragestellungen zu nähern. Denn allzu oft widerspricht das, was wir zu wissen glauben, der Realität. Marc Aurel, der gute Herrscher? Ja, aber nicht so, wie die heutige Öffentlichkeit den Philosophen auf dem Kaiserthron sieht.
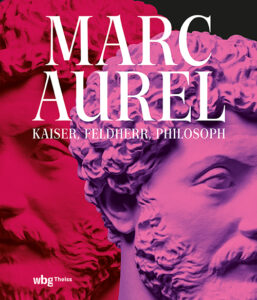
Marc Aurel. Kaiser, Feldherr, Philosoph
Hrsg.: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier
Theiss in der Verlag Herder GmbH
1. Auflage 2025
Gebunden, 400 Seiten
ISBN: 978-3-534-61047-1