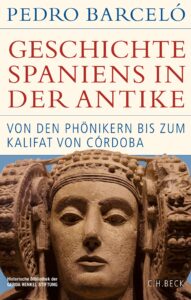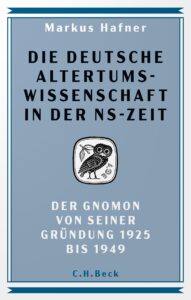Wer sich für die antike Geschichte der Iberischen Halbinsel interessiert, findet kaum deutschsprachige Publikationen, die auch die vorrömischen Epochen abdecken. Diese Lücke schließt Pedro Barceló nun. Er geht zunächst auf die frühen Bewohner ein und widmet sich dann phönikischen und griechischen Einwanderern, vor allem aber den Karthagern.
Überzeugend widerlegt er die These einer angeblichen frühen karthagischen Präsenz und analysiert sehr ausführlich die Zeit der Karthager in Hispanien wie den Hasdrubal-Vertrag und die Sagunt-Affäre oder die Konflikte mit den Römern bis zum Ende des zweiten römisch-karthagischen Krieges, der, wie Barceló veranschaulicht, zu einem entscheidenden Teil in Hispanien entschieden wurde.
Nach der Vertreibung der Karthager setzten sich die Römer endgültig auf der iberischen Halbinsel fest. Allerdings sollten noch etwa zweihundert weitere Jahre vergehen, bis die Eroberung unter Augustus als abgeschlossen gelten konnte. Die verschiedenen Stämme leisteten lange Widerstand, auch weil viele römische Statthalter hier vor allem die Möglichkeit sahen, sich auf Kosten der Einheimischen zu bereichern, und oft waren sie nicht gerade zimperlich in ihrer Vorgehensweise.
Mit Beginn der Kaiserzeit wandelte sich das Verhältnis zwischen Rom und Hispanien, wie Barceló am Beispiel Tarraco veranschaulicht. Schließlich gelang die Romanisierung der iberischen Halbinsel und ihrer Bewohner. Diese kann exemplarisch für die Romanisierung in anderen Regionen des Imperium Romanum gelten und so widmet er ein eigenes Kapitel den Faktoren einer solchen Romanisierung.
Barceló schildert die politischen Entwicklungen, Wirtschaft und Gesellschaft in der Hispania Romana bis zum Zeitalter des Theodosius und geht dann auf die Entwicklung des Christentums in Hispanien von den Anfängen bis zur Zeit der Völkerwanderung ein. Die neuen Einwanderer – Sueben Alanen, Vandalen und Westgoten – änderten im Laufe der Zeit die politische Gemengelage auf der Halbinsel, besiegelten letztendlich den Zusammenbruch römischen Herrschaft.
Aber auch das nun entstandene Westgotenreich mit Toledo als Hauptstadt konnte sich nicht auf lange Sicht behaupten. Ebenso wenig wie die Byzantiner, die sich ab der Mitte des 6. Jh. n. Chr. vorübergehend im Süden der iberischen Halbinsel festsetzten. Denn in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhundert begann der Siegeszug der zum Islam konvertierten Araber. Innerhalb weniger Jahrzehnte hatten sie ein riesiges Gebiet erobert und 711 n. Chr. landete ein aus Arabern und Berbern bestehendes Heer in der Ebene von Gibraltar. In nur sieben Jahren unterwarfen sie einen großen Teil der iberischen Halbinsel. Ihre Hauptstadt Cordoba zeigt exemplarisch die verschiedenen Epochen: über einer iberischen Kultstätte erhob sich später ein römisches Heiligtum, über dem man in der Zeit der Westgoten eine christliche Kirche errichtete. Diese wiederum musste einer Moschee weichen, in die dann später eine christliche Kathedrale eingebaut wurde.
Barceló ist es gelungen, mit dem vorliegenden Buch eine sehr detaillierte und dabei gut lesbare Analyse der politischen und historischen Entwicklung der Iberischen Halbinsel in der Antike vorzulegen. Zur besseren Übersicht hat Barceló im Anhang zudem ein Verzeichnis der antiken Orte mit ihren heutigen Bezeichnungen sowie eine chronologische Tabelle beigefügt.
Pedro Barceló
Geschichte Spaniens in der Antike. Von den Phönikern bis zum Kalifat von Córdoba
C.H.Beck Verlag, München 2025
492 S., 29 Ill., 10 Karten
38,00 Euro
Erhältlich bei Amazon oder beim Beck-Verlag.